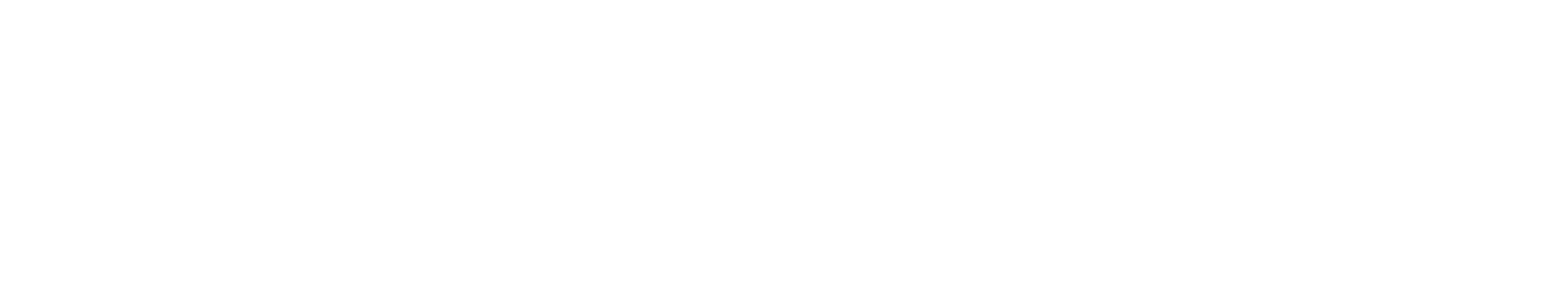Sakuranezumi, Japan, Serie 2015 – 2018 | © Yoshiko Kusano
Klappentext: Wie die Fotografie in die Welt gekommen ist und was die Menschen mit ihr gemacht haben. Zwischen 2009–2020 spannte Bernhard Giger in seinen Ausstellungen im Kornhausforum Bern einen Bogen von den Anfängen der Berner Fotografie-Geschichte bis zu den aktuellen Grenzgängen zwischen Dokumentarismus und Kunst.
Rheinfahrt-Schiffer an Land, Deutschland, frühe 1960er-Jahre | Staatsarchiv des Kantons Bern | © Albert Winkler
"Bernhard Giger – Referate über Fotografie 2009 – 2020" erscheint als Band # 10 der Publikationsreihe des Kornhausforum Bern und bietet nicht nur einen spannenden Einblick über vergangene Ausstellungen im Kornhausforum, sondern auch in die dazugehörigen Referate von Bernhard Giger. Der eine oder die andere wird sich beim Lesen der Referate an die Ausstellungen erinnern und sieht die Bilder vor dem inneren Auge, fragt sich vielleicht was der Fotograf oder die Fotografin heute macht…
Nilkanal mit Baumwollschiff, Alexandria, 1898 | Sammlung Tobler | © Augusta Flückiger
Im Vorwort beschreibt Christoph Reichenau den Werdegang Bernhard Gigers im Kornhausforum und welchen Stellenwert die Fotografie in Bern heute hat.
[…] Er hinterlässt eine Erinnerung, dass die wenig aufwändige, alles in allem "billige" Kunst der Fotografie keine billige Kunst ist, sondern eine, die höchsten Ansprüche stellt an die Komposition, den Augenblick des Auslösers, den Blick des Suchenden hinter der Kamera.
Er hinterlässt ein Bewusstsein, dass fotografische Bilder populär sind, Kunst mit niedriger Zugangsschwelle, demokratische Kunst, in der jede und jeder auf einer Fotografie etwas erkennt und dem Bild dadurch Bedeutung verleiht.
Er hinterlässt uns Kriterien dafür, was eine bessere Fotografie von einer schlechteren unterscheidet. Und dies, ohne in Zweifel zu ziehen, dass heute – und sei es mit dem Handy – jede und jeder selber fotografieren kann; eben: besser oder schlechter. Fotografieren als Teilhabe – hier hat das modisch gewordene Wort für einmal seine Berechtigung – an einer Kunst oder doch als Versuch, sich ihr praktisch anzunähern. […]
Bamako, 2009 | © Annette Boutellier
Konrad Tobler schreibt im Nachwort über Gigers Foto-Auge und schenkt ihm damit eine kleine Hommage: […] Das Foto-Auge also ist der genaue und neugierige Blick für Sujets, Augenblicke, Kompositionen, Licht- und Schattenspiele, Bewegungen im fotografischen Stillstand, Dramaturgien, Blickwinkel. Der genaue Blick: Das ist schliesslich die Fähigkeit des enthusiastischen, sprachbewussten und -kritischen Journalisten Giger, das Gesehene zu vermitteln, in Ausstellungen, in Einführungen, in leicht verständlichen, geschliffenen Bildlegenden, die den Blick der Betrachtenden behutsam in das Bild (ver-)führen.
Gigers Foto-Auge ist nun in der vorliegenden Publikation aufs Schönste dokumentiert. Dieses Foto-Auge hat, so wage ich zu behaupten, ganz bescheiden kleine und wichtige Kapitel der Fotogeschichte geschrieben. […]
Krönungsfeier für Hassan II. von Marokko, Marrakesch, 1961 | Stiftung Werner Schwarz | © Werner Schwarz
Bernhard Giger (*1952) ist in Bern geboren, nach einer Fotografenlehre bei Albert Winkler war er Programmmitarbeiter des Berner Kellerkinos, Film- und Fernsehkritiker und ab 1979 Redaktor zuerst siebzehn Jahre beim "Bund" und danach zehn Jahre bei der "Berner Zeitung" in den Bereichen Medien, Kultur und Stadtpolitik. Seit 1981 realisierte er Spielfilme für Kino und Fernsehen, unter anderen "Winterstadt" (1981), "Der Gemeindepräsident" (1984), "Tage des Zweifels" (1991), "Oeschenen" (2004) und mehrere Dokumentarfilme. Von 2009 – 2020 war er Leiter des Kornhausforums Bern.
Christoph Reichenau war 2007 – 2016 Präsident des Kornhausforum Bern. Von 2012 – 2014 war er Vorstandspräsident von Kulturvermittlung Schweiz.
Konrad Tobler (*1956) studierte Germanistik und Philosophie in Bern und Berlin. Seit 2007 ist er als freier Autor, Kulturjournalist, Kunst- und Architekturkritiker tätig. 2006 wurde er mit dem Preis für Kulturvermittlung des Kantons Bern ausgezeichnet.
Der Verlag edition clandestin wurde 1989 von Judith Luks gegründet. Im Zentrum der Publikationstätigkeit des in Biel/Bienne, Schweiz, domizilierten Verlages stehen Kunstbücher, bibliophile Vorzugsausgaben und Kunstblätter. Vermehrt werden auch belletristische Werke in Kombination mit Fotos, Zeichnungen und Illustrationen ins Programm aufgenommen, Richtung Graphic Novel. edition clandestin ist Mitglied vom SBVV und von SWIPS (Swiss Independent Publishers), der Plattform der unabhängigen Schweizer Verlage.
"Bernhard Giger - Referate über Fotografie 2009 – 2020" (ISBN 978-3-907262-15-3) kann direkt bei edition clandestin oder im Buchhandel bezogen werden.